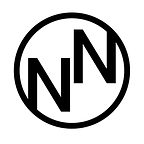Die unterschätzte Pause
Die Pause verbindet zwei Phasen miteinander, in denen etwas geschieht. Sie ist die Zeit dazwischen, sie gliedert unseren Alltag. Und doch vergessen wir sie häufig und begegnen ihr nicht mit der Wertschätzung, die sie verdient. Höchste Zeit, das zu ändern!
von Louka Goetzke
Bei einem klassischen Konzert entsteht die erste Pause, noch bevor das Stück beginnt. Das Publikum hört andächtig zu, in der Stille wächst die Spannung. Die Dirigentin betritt die Bühne, kurz braust Applaus auf, es folgt wieder Stille. Dann hebt sie die Arme und das Orchester beginnt zu spielen.
Ein Konzert kann nur mit einer Pause beginnen. Auch die Pausen zwischen den Stücken und im Notentext sind mindestens so wichtig wie die Noten selbst. Pausen gehören zur Musik wie zu einer guten Rede. Worte können zwar mächtig sein, die gut eingesetzte Pause aber ist mächtiger. Helmut Schmidt war ein bekannter Meister der Kunstpause. Auch gute Redner wie Martin Luther King und Steve Jobs wussten die Pause zu nutzen, sie machten beim Sprechen fast doppelt so viele Pausen wie ein*e durchschnittliche*r Sprecher*in.
Eine Pause markiert eine Unterbrechung. Nach einer Pause geht es weiter, vielleicht beginnt auch etwas Neues. Fest steht aber: Die Pause ist begrenzt, sie ist die Zeit dazwischen — zwischen zwei Worten, zwei Akten im Theater, Schulstunden, zwischen den beiden Halbzeiten eines Fußballspiels. Die Pause ist ein Übergang, sie markiert ein Austreten aus gewohnten Zeitmustern und gliedert so unseren Alltag. Sie schafft gleichzeitig Verbindung und Distanz zwischen dem Vorhergehenden und dem Nachfolgenden. Als Zeit der Nicht-Zeit, als Auszeit, als Handlung der Nicht-Handlung ist die Pause paradox.
Wer nicht raucht, steht häufig vor dem Problem, keinen Anlass für kleine Pausen im Arbeitsalltag zu haben.
Von der Notwendigkeit der Pause
Wir alle brauchen Pausen. Etwa ein Drittel unseres Lebens müssen wir ruhen, pausieren, schlafen. Durch eine Pause können wir Abstand gewinnen und nachdenken, neue Kraft tanken. Eine Auszeit ist ein konstituierendes Element der Alltagszeit; wir können Pausen nutzen, um durchzuatmen und uns neu zu sortieren. Der berühmte Eureka-Moment, das Aha-Erlebnis, bei dem plötzlich der Groschen fällt, kommt erst, wenn wir unserem Gehirn einen Moment Auszeit gönnen. Die englische Dichterin Elizabeth Barrett Browning schrieb bereits im 19. Jahrhundert, nichts bringe uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause. Auch im Sport erzielt ein Training mit ausreichend Regenerationspausen bessere Ergebnisse; ein Training ohne Erholung ist wesentlich ineffizienter, da das eigentliche Wachstum der Muskeln in der Pause stattfindet.
Eine Pause ist auch ein Handlungsraum, denken wir nur an die Beziehungen, die geknüpft, und die Entscheidungen, die getroffen werden, wenn Kolleg*innen für eine gemeinsame Zigarettenpause vor die Tür treten. Wer nicht raucht, steht häufig vor dem Problem, keinen Anlass für kleine Pausen im Arbeitsalltag zu haben. Dabei wäre es durchaus möglich, sich welche zu schaffen! Ein Beispiel für eine institutionalisierte Pause findet sich in der schwedischen Unternehmenskultur: Fika beschreibt die schwedische Kunst, Pause zu machen. Als hundert Jahre alte gesellschaftliche Praxis hat sie einen hohen Stellenwert im Alltag vieler Schwed*innen. Bei der traditionellen Kaffeepause mit Fikabröd, süßem Gebäck, geht es vor allem darum, sich mit Kolleg*innen, Freund*innen oder der Familie auszutauschen.
Eine Pause kann auch eine belastende Auszeit sein. Es gibt unfreiwillige Pausen, etwa durch Krankheit, durch ungewollte Erwerbslosigkeit oder nach Überarbeitung, wenn wir einfach nicht mehr können und Pause machen müssen. Genauso wie der Stau auf der Autobahn ist die quälende Stille im Aufzug oder die Lücke im Lebenslauf selten willkommen.
In unserer Grammatik ist die Wichtigkeit der Pausen fest verankert: Ein Semikolon verbindet zwei gleichwertige Sätze miteinander, es markiert eine Pause anstelle eines Endes, dem Punkt. Im Semikolon-Projekt der Amerikanerin Amy Bleuel steht es für einen Satz, den die Autorin hätte beenden können, aber nicht beendet hat; gemeint ist damit ihr Leben. Das Anti-Suizid-Projekt leistet heute Aufklärungsarbeit und sensibilisiert für Depressionen und andere Formen psychischer Erkrankungen.
Wenn für die Pause keine Zeit bleibt
Die Zeit ist eines unserer bedeutendsten sozialen Ordnungsprinzipien und stets im Wandel. Was wir als Pause erleben und verstehen, bestimmen unsere gesellschaftlichen Zeitnormen. Die Moderne ist vom Gefühl einer knappen, davoneilenden Zeit definiert. Es heißt, wir leben in einer pausenlosen Gesellschaft. Doch schon Shakespeares Hamlet beklagt, die Zeit sei aus den Fugen geraten. Goethe spricht von einem veloziferischen Charakter unserer Zeit, die nichts wachsen und reifen lasse, und Friedrich Nietzsche schrieb Ende des 19. Jahrhunderts, der Mangel an Ruhe lasse unsere Zivilisation auf eine neue Barbarei zusteuern: „Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche Element in großem Maße zu verstärken“, schreibt er in Menschliches, Allzumenschliches. Die Beschäftigung mit dem Gefühl, nicht genug Zeit zu haben, ist also kein neues Phänomen. Schon vor 140 Jahren wurde Nervosität als Zivilisations- und Zeitkrankheit beschrieben, als eine direkte Folge des beschleunigten und hektischen Lebens.
Was wir als hektisch empfinden, hat sich in den letzten Jahrhunderten allerdings stark verändert. Bis ins 16. Jahrhundert hinein waren Minuten und Sekunden keine relevanten Größen im Zeitempfinden. Wir gewöhnen uns kontinuierlich an die Veränderung der Zeitstrukturen. Als zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine Eisenbahn das erste Mal mit schlappen 28 Kilometern pro Stunde von Nürnberg nach Fürth fuhr, warnten Ärzt*innen vor der krankmachenden Geschwindigkeit und die Mitfahrenden klagten über Kopfschmerz und Schwindel. Heute rasen wir mit bis zu 330 Kilometern pro Stunde über die Schienen und fragen uns, ob wir nächstes Mal nicht lieber fliegen sollten, um mehr Zeit zu sparen, weil wir denken, dass es unser Leben besser macht.
Damit es danach schneller weitergeht
Fragen nach dem guten Leben sind eng verknüpft mit Zeitpolitik. Damals wie heute wird das stetig wachsende Gefühl eines herrschenden Zeitmangels beklagt. Zeit haben ist eine Form des Wohlstands geworden: Zeitwohlstand. Der Soziologieprofessor Hartmut Rosa sagt, die Zeit gehe uns heute eher aus als das Rohöl. Wir seien am Rande der Erschöpfung und am Rande des Sinnvollen angelangt. Der Optimierungs- und Steigerungszwang der beschleunigten Moderne mache uns krank. Der Philosoph Byung-Chul Han fordert deswegen eine Zeitrevolution, die sich neoliberaler Zeitpolitik widersetzt und eine neue Zeit einläutet, ohne Steigerungs- und Effizienzdruck. Derweil empfehlen uns Sprüchekalender und Arbeitszeitforscher*innen gleichermaßen eine Pause vom stressigen Alltag; der Aufruf zur Wiederentdeckung der Langsamkeit steht heute neben Liebeserklärungen an die Pause. Doch wie viele Pausen brauchen wir, was zählt als Pause, und für was oder wen pausieren wir? Nur damit es danach schneller und besser weitergeht, damit wir effizienter arbeiten können?
Die Pause als Unterbrechung ergibt nur da Sinn, wo es sonst eine wahrgenommene Kontinuität gäbe. Erst durch die Industrialisierung kam die Pause als eine Pause von der Arbeit auf — und mit ihr die Unterscheidung von Arbeit einerseits und Freizeit als Nicht-Arbeit andererseits, durch die zahlreiche Care-Tätigkeiten wie unbezahlte Hausarbeit oder Kinderbetreuung unsichtbar wurden. Seitdem sind Arbeitszeit und Arbeitspausen Gegenstand zentraler gesellschaftlicher Aushandlungen. Karl Marx und Friedrich Engels verstanden die Fabrikuhr und ihren Signalton zum Beispiel als Mittel der Ausbeutung von Arbeiter*innen. Über die verschiedenen Industrialisierungsphasen haben sich Tages- und Wochenrhythmen gewandelt: Es wurden Pausenregelungen eingeführt, manche in jüngerer Zeit aber auch wieder abgeschafft oder eingeschränkt, wie die sogenannte Steinkühlerpause, eine Fünf-Minuten-Pause je Arbeitsstunde in der Metallindustrie, die seit 1996 nur noch für Akkordarbeiten am Fließband gilt.
Das Recht, nichts zu tun: Der Kampf um die Pause
Unser Recht auf Pausen während der Arbeitszeit und zwischen den Arbeitstagen verdanken wir 150 Jahren Gewerkschaftsarbeit. War 1830 vielerorts eine 80-Stunden-Woche die Regel, erreichte im Jahr 1873 der Verband der Deutschen Buchdrucker die erste Arbeits- und Pausenregelung überhaupt: Bei einem zehnstündigen Arbeitstag gab es je 15 Minuten Pause für Frühstück und Abendbrot. Nach der Novemberrevolution erkämpften Gewerkschaften dann den Acht-Stunden-Tag. Bis heute sind Pausenregelungen Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmen.
Allzu häufig gilt: Eine zu lange Pause wird als ineffizient verstanden, wer dauernd Pause macht, ist faul. Dieses Mindset verbindet der Philosoph und Soziologe Max Weber schon Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem protestantischen Arbeitsverständnis. Er beschreibt eine Arbeitsethik, nach der Arbeit Pflicht ist und Zeitvergeudung eine Sünde. Persönlicher sowie wirtschaftlicher Erfolg werden als Zeichen für ein Auserwähltsein durch Gott interpretiert. Diese Ethik sei ein wichtiger Motor für die Industrialisierung und den Kapitalismus, deren Erfolg auf der verinnerlichten Selbstdisziplinierung jedes und jeder Einzelnen aufbaue. Die innerweltliche Askese, also das Aufschieben von Genuss und das Verbot unbefangenen Genießens, bedeuten auch ein Aufschieben der Pause. Pausieren dient in diesem Kontext einzig der Erholung, um anschließend noch fleißiger arbeiten zu können. Die Macht der Pause zu nutzen, um danach produktiver zu sein, bedeutet, Pausen zu nutzen, um mehr arbeiten zu können. Wenn eine Arbeitspause nur eine Phase der Arbeitszeit ist, zählt sie dann noch als Pause?
Die Krux der Zeitsouveränität
Heute, so scheint es, geben wir bereitwillig die Pausen auf, für die Generationen von Arbeiter*innen hart gekämpft haben. Seit 1994 regelt das Arbeitszeitgesetz in Deutschland das Recht auf Urlaub und Pausen und erklärt die gesetzliche Pause zur Pflicht. Doch Modelle mit flexiblen Arbeitszeiten — beispielsweise die Vertrauensarbeitszeit — ermöglichen es, sich auszusuchen, wann genau man arbeitet. Bei dieser Art der Entgrenzung der Arbeit bleibt die Auszeit aber oft auf der Strecke. Studien zeigen, dass völlige Arbeitszeitautonomie zu mehr Überstunden führt. Wenn Urlaubstage nicht mehr festgelegt werden, fühlt sich das nach Freiheit und Selbstbestimmung an, tatsächlich wird im Schnitt aber weniger Urlaub genommen. Das machen sich Unternehmen zunutze.
Scheinbar gilt: Wenn wir selbstbestimmt Pause machen können, machen wir sie oft gar nicht. Vielleicht ist der Arbeitsdruck zu hoch, vielleicht denken wir aber auch, uns eine Pause erst verdienen zu müssen, und handeln nach einer internalisierten Arbeitsethik — nehmen die an uns herangetragenen Aufgaben wichtiger als unsere eigenen Bedürfnisse. Ohne Pausen, ohne Rhythmus, der unseren Alltag strukturiert, herrscht das „Immer“, die ständige Verfügbarkeit. Verändert sich das, wenn wir selbstorganisiert arbeiten? Wie sieht Pausemachen aus, wenn es keine*n Chef*in mehr gibt?
Eine Auszeit kann viel mehr sein als bloß eine Phase der Nicht-Arbeit.
Welche Rolle die Pause für uns spielt, hängt auch davon ab, welches Verhältnis wir zur Arbeit und zur Freizeit haben. Der Soziologe Jürgen Habermas unterscheidet drei verschiedene Funktionen von Freizeit: erstens Regeneration im Sinne einer Erholung. Ein Beispiel findet sich in unserem Arbeitsrecht. Dort wird Urlaub als eine Erholung beschrieben, mit dem Ziel, unsere Arbeitskraft wiederherzustellen. Die Kompensation hingegen soll den Arbeitsstress und die durch die Arbeit erlebte Frustration ausgleichen. Sie kann auch als Flucht vor anstrengender Arbeit gesehen werden, um anschließend wieder diszipliniert weiterarbeiten zu können. Dieser Art der Freizeit steht Habermas, der darin eine Verfestigung entfremdender Arbeitsverhältnisse erkennt, kritisch gegenüber. Die dritte Funktion von Freizeit nach Habermas ist Suspension, sie will Versagungen aus der Arbeitswelt suspendieren und zielt auf echte Bedürfniserfüllung ab, die im Arbeitskontext nicht möglich sei. Darunter fällt für Habermas zum Beispiel das politische Engagement, für das aber den meisten neben der Lohnarbeit die Energie fehle. Gleichzeitig wird Freizeit mehr und mehr ökonomisiert und konsumierbar, spätestens seitdem die Marketingforschung Ende der 80er Jahre die Erholung als Marktlücke entdeckte. Die Auszeit der einen wird dann mit der Arbeit der anderen erkauft.
In unserer Gesellschaft haben wir das Leistungsprinzip aus der Arbeitswelt auf die Freizeit übertragen. Pausen sollen richtig eingesetzt werden, effektiv sein, etwas bringen. Dabei würde es auch anders gehen, denn: Eine Auszeit kann viel mehr sein als bloß eine Phase der Nicht-Arbeit. Es ist entscheidend, was wir unter Pause verstehen und wie wir sie gestalten. Zeitsouveränität und Möglichkeiten zur Pause im Sinne einer Erholung sind eine Errungenschaft, die wir schätzen sollten.