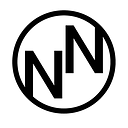Social Entrepreneurship: Weltretten mit Businessplan
Sozialunternehmen sind der Inbegriff einer verantwortungsvollen Wirtschaft — und ihre Gründung meist eine Herausforderung. Trotzdem brauchen sie kein Mitleid, sondern einfache, kluge Rechtsformen und Förderer, die auch auf Sinn wert legen, anstatt nur profitorientiert zu denken. Jyoti Fair Works ist ein Beispiel dafür, wie das Weltretten mit Businessplan gelingen kann.
Text: Louka Goetzke
Bilder: Martha Starke, Janosch Kunze & Jeanine Glöyer
Alles begann im Frühjahr 2010, mit einer Schnapsidee, wie Jeanine Glöyer sie heute nennt: „Ich dachte mir, die Stoffe in Indien sind so schön und nähen kann ja nicht so furchtbar schwer sein. Aber eigentlich hatte ich keine Ahnung.“ Jeanine wollte sich nie selbstständig machen oder gar ein Unternehmen gründen. Doch was vor neun Jahren klein begann, ist heute zu einem gut laufenden Fair Trade Label namens Jyoti herangewachsen, mit einer Näherei in Indien, einem Laden in Berlin und einem Onlineshop. „Das ist aus Versehen passiert“, sagt Jeanine und lacht.
Jyoti Fair Works zählt zu den zwei Prozent der Unternehmen in Deutschland, die ein soziales Ziel verfolgen. „Sozialunternehmen“, heißt es in einem im Januar 2017 veröffentlichten Papier der Bundesregierung, „spielen damit bei der Lösung aktueller gesellschaftlicher und sozialer Herausforderungen … eine zunehmend wichtige Rolle. Indem sie unternehmerisches Denken mit einem sozialen Mehrwert verbinden, kommt ihnen zugleich eine wichtige Brückenfunktion für die Integration von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik zu.“ Wer ein Sozialunternehmen gründet, will gesellschaftliche Herausforderungen mit unternehmerischen Mitteln angehen. Damit widersetzen sich diese Firmen, wirtschaftlichen Vereine und Stiftungen der Unterteilung in einen wirtschaftlichen und einen sozialen Sektor. Manche Sozialunternehmer*innen treten gleich mit einem Businessplan an, der ökonomische Ziele vorgibt. In anderen Fällen, wie bei Jyoti Fair Works, steht ein soziales Projekt im Vordergrund und der unternehmerische Aspekt entwickelt sich als Teil eines Social Business erst mit der Zeit.
Eine Firma gründen: Von der Idee zum Businessplan
Aber zurück zum Anfang: Nach ihrem Abitur geht Jeanine 2008 für einen Freiwilligendienst nach Chittapur in den Südwesten Indiens. Dort arbeitet sie in der von indischen Frauen geleiteten NGO Jyothi Seva Kendra (wörtlich: jemandem ein Licht bringen), die eine Schule und ein kleines Krankenhaus betreibt. In dieser Zeit freundet sie sich mit den Frauen in der Organisation an und erfährt von deren schwierigen Lebensbedingungen in der strukturschwachen Region Karnatakas: Viele sind arbeitslos oder können trotz Lohnarbeit die Schulbildung ihrer Kinder nicht finanzieren. Als Jeanine wieder zurück in Deutschland ist, lassen sie diese Erfahrungen nicht los: „Ich dachte, irgendwas muss man da doch machen können. Etwas, das nachhaltiger ist als eine einfache Spende, damit die Frauen auf ihren eigenen Füßen stehen können.“
Betriebswirtschaftliche Erfahrung hatte sie zu Beginn nicht, ebensowenig Startkapital zur Finanzierung. Aber eine Idee: „Ich sagte mir: Der Wechselkurs ist doch ganz gut und vielleicht könnte man da ein kleines Nähprojekt aufbauen und die Frauen fest anstellen.“ Für Jeanine ging es also nie darum, ein Kleidungslabel zu gründen. Sie wollte den Frauen in Indien Arbeit geben und sie dafür fair entlohnen. Um das zu ermöglichen, sollten die Produkte, die sie herstellen, in Deutschland verkauft werden. So sollten die Frauen eine langfristige, gute Anstellung haben und nicht mehr auf Spenden angewiesen sein.
Jeanine bespricht sich mit einer Koordinatorin der NGO in Indien und fragt, ob Interesse an einer Zusammenarbeit bestehe. „Ja, das können wir schon machen“, sagt diese. „Das hört man in Indien aber öfter und ich wusste nicht so genau, was ich davon halten soll“, erinnert sich Jeanine. Eine Woche später jedoch ruft die Koordinatorin Jeanine an: Sie habe jetzt zehn Frauen hier sitzen und sie könnten loslegen. Die Nähmaschinen hätten sie auch schon organisiert, wie es denn jetzt weitergehe. „Da war ich ziemlich baff, das war ja nur so eine Idee von mir“, sagt Jeanine, man hört noch immer die Überraschung in ihrer Stimme. Jeanine ist unter Zugzwang. „Ich wusste auch nicht, wie wir das machen sollen. Ich konnte nicht nähen und die Frauen konnten nicht nähen, das war unser erstes großes Hindernis“, erzählt sie und schmunzelt, wenn sie sich an diese ersten Schritte des Projekts erinnert. „Deswegen sage ich auch immer: Ich hab die Firma gar nicht selbst gegründet, das haben eigentlich die Frauen in Chittapur getan.“
Im Hintergrund Herzblut — und unzählige Stunden ehrenamtliche Arbeit
Die ersten fünf Jahre arbeitet Jeanine komplett ehrenamtlich an dem Projekt und trägt selbst viele der Reise- und Standkosten, die anfallen, um die Produkte auf Märkten zu verkaufen. „Ich hatte während meines Studiums nicht den Druck, davon leben zu müssen. Das hat am Anfang total geholfen, weil ich alles viel entspannter angehen konnte und viele Probleme erst gar nicht aufgetreten sind.“ Eine komfortable Situation einerseits, andererseits ein Engagement, das für das Entstehen und Überleben vieler nachhaltiger Organisationen notwendig scheint.
Oft leben sie von unbezahlter Arbeit: Laut einer Umfrage des Deutschen Social Entrepreneurship Monitor 2018 (DSEM) engagieren sich in über der Hälfte (56,8 Prozent) der DSEM-Sozialunternehmen Ehrenamtliche mindestens in Teilzeit. Klar, wer Sinn in seiner*ihrer Arbeit sieht, ist gerne bereit, dafür auch am Abend oder Wochenende Zeit aufzubringen oder das Projekt neben Studium oder Lohnarbeit aufzubauen. Für über 92 Prozent der befragten Sozialunternehmen ist der soziale Impact ein Hauptmotiv für ihre Arbeit. Für ganze 46 Prozent stehen die sozialen Ziele sogar über den ökonomischen Zielen. Und für mehr als die Hälfte aller befragten Sozialunternehmen haben ökonomische und soziale Ziele die gleiche Wichtigkeit.
„Mehr als ein Drittel aller Sozialunternehmen finanziert sich zu Beginn aus eigenen Ersparnissen.“
„Es sind auf jeden Fall unendlich viele Stunden in ehrenamtliche Arbeit eingeflossen“, sagt Jeanine. Sie glaubt, dass dies bei Jyoti der Grund für die breite Unterstützung war, die sie im Laufe der Jahre erfahren hat: „Leute haben eher Lust, sich in ein Projekt einzubringen, wenn klar ist, dass ich nicht selbst von dieser Arbeit profitieren will. Viele Menschen waren super motiviert, mitzumachen, weil es zunächst darum ging, vor Ort in Indien eine Perspektive zu schaffen.“ Schon nach eineinhalb Jahren lassen sich die Kosten in Indien durch die Verkäufe decken, in Deutschland trägt sich das Projekt aber erst seit zwei Jahren komplett selbst.
Fair Trade und Förderung
Da Sozialunternehmer*innen nicht primär profitorientiert arbeiten, dauert es meist länger, bis die Finanzierung sichergestellt ist; viele wachsen über Jahre nicht oder nur wenig. Große Investor*innen oder Kapitalgesellschaften haben selten Interesse an dem sozialen Impact eines Start-ups, Förderprogramme fokussieren sich in Deutschland bisher eher auf Technologien. Wer eine App erfindet oder eine neue Technologie auf den Markt bringt, hat deutlich bessere Chancen bei der Existenzgründung. Das trifft aber gerade einmal auf ein Viertel aller Sozialunternehmungen in Deutschland zu. Obwohl es seit Jahren mehr und mehr Impact-Investment gibt, also Kapitalgeber*innen, die sich auch für die soziale Rendite ihrer Investitionen interessieren und wirkungsorientiert investieren, ist der Anteil jedoch nach wie vor verschwindend gering. Zusätzlich existieren zwar zahlreiche Innovations- und Gründerzentren in Deutschland, doch eine ähnliche Infrastruktur speziell für Sozialunternehmen muss erst noch aufgebaut werden. Mehr als ein Drittel aller Organisationen finanziert sich deshalb zu Beginn aus eigenen Ersparnissen.
So fiel auch Jyoti Fair Works durch die meisten Förderraster durch. „Unser Hauptproblem war, dass wir kein Tech-Start-up sind. Wir nähen einfach nur“, sagt Jeanine.
Förderprogrammen war das nicht innovativ genug für ein Investment, so die Begründung in den Absagen. Jeanine wollte in einer bestehenden Industrie etwas besser machen, erfand dafür nichts neu, sondern versuchte, mit ihrem kleinen Projekt Wege zur Herstellung von Kleidung unter fairen Bedingungen zu finden. Geebnet wurden diese zu Beginn durch eine Spende von einer Hamburger Schule, dazu kamen auch immer wieder kleine Beträge von Privatpersonen. Crowdfundings finanzierten drei Jahre lang den Kauf von Stoffen. Von 2013 bis 2014 war Jeanine dann Stipendiatin im Social Impact Lab in Berlin, das zwar keine finanzielle Unterstützung bereitstellte, aber dennoch bei der Professionalisierung half und neue Mitstreiter*innen zu Jyoti brachte.
Mit dem Projekt, das vor neun Jahren begann, hat Jyoti Fair Works heute nicht mehr viel zu tun. Zu Beginn gab es nur Jeanine und zehn Frauen in Indien, heute ist die Gruppe auf 27 Frauen angewachsen, 5 in Berlin und 22 in Indien. Die Arbeitsstätte in Chittapur ist für die Näherinnen inzwischen auch ein Ort, an dem sie sich austauschen und gegenseitig unterstützen können. „Viele der Frauen, mit denen wir arbeiten, haben einige Probleme zu Hause“, erzählt Jeanine. Die anderen Frauen in der Organisation stellten da eine wichtige Bezugsgruppe dar. Gleichzeitig haben sie sich über die Jahre professionalisiert: „Am Anfang wurden wir vor allem als kleines nettes Charity-Projekt wahrgenommen. Jetzt verstehen wir uns als erwachsenes Fair-Trade-Modelabel, das kein Mitleid mehr braucht“, erklärt Jeanine stolz. Die Frauen können inzwischen alle ausgezeichnet nähen und sind zum Teil wiederum selbst zu Ausbilderinnen für neue Näherinnen geworden. „Wenn die Leute jetzt bei uns kaufen, haben sie nicht mehr das Gefühl, sie spenden was. Sie bekommen ein qualitativ hochwertiges Produkt, das durch und durch fair und seinen Preis wert ist.“
Der Weg zu einer nachhaltigen Wertschöpfungskette
Auf der Website von Jyoti sind heute Informationen zum ökologischen und fairen Herstellungsprozess und den verwendeten Materialien zu finden. Von Anfang an ist es Jeanines Anspruch, die gesamte Lieferkette und alle Schritte des Produktionsprozesses nachzuvollziehen. Als Jeanine 2009 damit beginnt, gestaltet sich die Suche nach zertifizierten Produzent*innen in Indien aber als sehr schwierig, denn zu dieser Zeit befindet sich die faire Modebranche noch am Anfang. Als kleines Unternehmen hat Jyoti Fair Works zudem Nachteile im Vergleich zu großen Modelabels: Haben sie dann doch einmal eine*n der wenigen zertifizierten Produzent*innen gefunden, sind diesen ihre Abnahmemengen häufig zu klein, denn es können sich zu dieser Zeit meist nur große Produzent*innen Zertifizierungen leisten. „Die hatten dann kein Interesse daran, mit so kleinen Fischen wie uns zusammenzuarbeiten“, erinnert sich Jeanine an den mühsamen Weg hin zu einer transparenten Wertschöpfungskette.
Da die Betriebe, die Jeanine und ihr Team nach langer Suche finden, keine Stoffe an sie verkaufen, versuchen sie, die Sache anders anzugehen. Jeanines Kollegin Carolin reist Tausende Kilometer durch Indien und besucht Stofffabrikant*innen vor Ort, auf der Suche nach extra kleinen Produzent*innen, die damals noch kein Gütesiegel hatten und teilweise bis heute keines haben. Bei Betrieben mit zwei oder drei Personen überzeugt sie sich vor Ort selbst von den Arbeitsbedingungen und legt dabei eigene Kriterien an. „Wenn die Person, die den Stoff herstellt, direkt von uns bezahlt wird, dann kann ja nicht viel schiefgehen“, so der Gedanke dahinter. Ohne Mittelsmenschen stellt Jyoti sicher, dass das Geld auch vollständig bei den Menschen ankommt, die die Arbeit machen.
Keine passende Rechtsform
Trotz des aufwendigen Prozesses zum Nachvollzug der Wertschöpfungskette sagt Jeanine heute, nach neun Jahren, die größte Herausforderung sei die Gründung des Unternehmens in Deutschland gewesen. „Das hat ewig gedauert, bis wir uns da durchgearbeitet hatten, welche Form überhaupt passen könnte.“ Gut 46 Prozent der DSEM-Teilnehmenden sehen das Fehlen einer passenden Rechtsform für Sozialunternehmer*innen als wesentliche Hürde. Markus Sauerhammer, Vorstand des Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e.V., sagt sogar: „Die meisten Social Start-ups in Deutschland entstehen bislang nicht wegen, sondern trotz der politischen Rahmenbedingungen.“
Schlussendlich entscheidet sich Jyoti Fair Works für eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Diese Form bewährt sich aber nicht: Bisher kann Jyoti wegen der Gemeinnützigkeit einen Großteil der Ausgaben in Deutschland nicht steuerlich absetzen. Deswegen machen sie jetzt aus der gUG eine GmbH, an die über einen Lizenzvertrag ein gemeinnütziger Verein angebunden ist. Doch auch diese Umformung ist kompliziert und schwierig: „Die Finanzämter kennen so etwas nicht, die denken, entweder wir sind blöd oder betreiben Geldwäsche“, erzählt Jeanine. Meist seien sie misstrauisch und überfordert. „Wir haben uns aber gesagt: Wenn wir zugrunde gehen, dann nicht wegen eines Finanzamts. Das wäre wirklich zu traurig.“
Nachhaltigkeit statt Wachstum
An ihrer Art zu wirtschaften soll sich, wenn Jyoti Fair Works eine GmbH wird, aber nichts ändern: „Wir sind immer noch die gleichen Leute mit der gleichen Motivation.“ Sie überweisen weiter ihre Gewinne zu 100 Prozent nach Indien, um dort Alphabetisierungs- oder Englischkurse für die Näherinnen zu finanzieren. „So können sich die Frauen vielleicht irgendwann selbstständig machen oder einen Job vor Ort finden, für den sie vorher nicht qualifiziert waren“, so Jeanines Hoffnung.
Sozialunternehmen wird häufig vorgeworfen, dass sie zwar mit Herzblut bei der Sache seien, mit ihren Konzepten aber lediglich Symptome bekämpften oder Probleme lösen wollen, die sie vorab nicht ausreichend analysiert haben. Somit bleibe die erhoffte Veränderung häufig auf der Strecke. Bei Jyoti Fair Works scheint das nicht der Fall zu sein. In der engen Zusammenarbeit mit der NGO Jyothi Seva Kendra vertrauen Jeanine und ihre Kolleginnen darauf, dass die Partnerinnen vor Ort in vielen Dingen besser Bescheid wissen. Außerdem setzt das Projekt darauf, die Frauen dazu zu ermächtigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Jeanine lacht: „Bisher hat das aber noch nicht so gut funktioniert, weil uns keine mehr verlassen will.“
Seit zwei Jahren finanziert Jyoti alle Ausgaben in Deutschland und Indien über den Handel mit ihren Produkten und ist nicht mehr auf Spenden angewiesen. „Unser Ziel ist es nicht, reich davon zu werden, sondern unsere Miete zahlen zu können. Und das läuft.“ Es läuft sogar so gut, dass sie gerade eine zweite Nähwerkstatt in einem anderen indischen Ort eröffnet haben und dort das gleiche Konzept wie in Chittapur umsetzen. Bei der Ausweitung der Produktion ist es Jeanine wichtig, es langsam angehen zu lassen, von Wachstumssehnsucht keine Spur. Obwohl sie zeitweise nur noch auf Warteliste produzieren konnten, stellen sie nicht überstürzt neue Näherinnen ein. „Wir wissen, wie fragil die Strukturen vor Ort sind“, sagt Jeanine. Der intime Rahmen in der kleinen Werkstatt soll für die Frauen erhalten bleiben. Deswegen haben sie sich dagegen entschieden, den jetzigen Standort zu erweitern oder einen Teil der Produktion auszulagern: „Unser Kernkonzept bleibt es, genau zu wissen, mit wem wir zusammenarbeiten.“
Unsere drei Take-Aways zum Social Entrepreneurship:
1.Für fast die Hälfte der Sozialunternehmen stehen soziale Ziele über den ökonomischen.
2.Obwohl die ersten Jahre für die meisten Sozialunternehmen nicht leicht sind, gelingt es ihnen, individuelle Lösungen für faires Wirtschaften und Arbeiten zu finden.
3.Wachstum und sozialer Fokus schließen sich nicht aus: Im Online Shop von Jyoti findet ihr mittlerweile nicht nur Fair Trade Kleidung, sondern auch Kuscheltiere und Einrichtungsgegenstände.