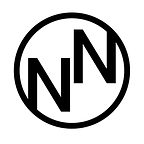Streitet euch! Warum wir Gefühle und Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz brauchen
Gefühle sind in unserer Arbeitswelt tabu. Doch wo keine Gefühle sein dürfen, ist auch kein Raum für Streitigkeiten. Und das ist ein Verlust: Gutes Streiten stärkt den Zusammenhalt und hilft uns dabei, unsere Argumente zu schärfen.
von Louka Goetzke und Martin Wiens
In der schönen, neuen Arbeitswelt ist alles total super. Zur Begrüßung umarmen sich die Kolleg*innen, wenn sie nach Hause gehen auch. Regelmäßig gibt es Wohlfühlduschen, bei denen sich alle gegenseitig sagen, was sie richtig gut aneinander finden. Kritik heißt nicht mehr Kritik, sondern Feedback und ist ein Geschenk, das der*die Empfänger*in auspacken kann oder nicht, je nachdem, wie hilfreich es für die persönliche Weiterentwicklung erscheint. Wenn jemand einen Fehler macht, kommt kein*e Chef*in, um sie*ihn anzubrüllen: nicht nur, weil neue Organisationen zunehmend versuchen, die Chef*innenposition abzuschaffen, sondern auch, weil sich mittlerweile herumgesprochen hat, dass Lautwerden als Führungsmethode nicht taugt.
Das alles ist gut so, aber es hat auch einen Nachteil: Wo alles super ist, wird nicht gestritten. Wir glauben aber: Organisationen neuen Typs müssen die Lust am Streiten für sich entdecken und zur Meisterschaft bringen. Denn nur, wo gut gestritten wird, kann sich auch was zum Besseren bewegen.
Warum streiten wir überhaupt?
Streit entsteht durch Differenzen. Zwei Menschen oder Gruppen wollen Unterschiedliches. Nun ist es möglich, gegenseitige Differenzen anzuerkennen, ohne dass es zum Streit kommt. Kollegin A trinkt lieber Kaffee, Kollege B will Tee. Stellen wir eben eine Kaffeemaschine und einen Teekocher in die Büroküche, kein Problem. Unterschiedliche Interessen führen noch nicht zum Streit. Dazu kommt es nur, wenn sich die Interessen wirklich in die Quere kommen.
Das Wort Konflikt kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Zusammenstoß oder Widerstreit. Laut dem Friedensforscher Johan Galtung ist ein Konflikt dann unvermeidbar, wenn es miteinander unvereinbare Zielvorstellungen gibt, wenn also das Erreichen des einen Ziels das Erreichen des anderen ausschließt. Gibt es in der Küche also nur Platz für entweder die Kaffeemaschine oder den Teekocher, sieht die Sache schon anders aus. Wenn die Positionen der einen die des anderen infrage stellen, dann kommt es zum Zusammenstoß. Ein friedvolles Nebeneinander ist dann nicht möglich.
Wenn wir zusammenarbeiten und zumindest ein bisschen mit dem Herzen bei der Sache sind, sind Zusammenstöße unvermeidbar. Eine Menge Kollateralschäden können wir dadurch verhindern, dass wir dann produktiv miteinander streiten — damit stärken wir sogar unsere Zusammenarbeit und Beziehungen. Politolog*innen, Soziolog*innen und Philosoph*innen gehen davon aus, dass produktiver Streit auf lange Sicht den Zusammenhalt stärkt und integrierend wirkt. Fest steht aber auch: Menschen und Organisationen können sich zerstreiten, sich im Streit entzweien. Was unterscheidet einen schlechten von einem guten Streit? Und was brauchen wir, um gut zu streiten?
Bis aufs Blut: Aus der Kulturgeschichte des Streitens
Mithilfe von Streit handeln wir Konflikte aus — er ist eine Konstante menschlichen Zusammenlebens, der Kern und Beginn vieler Epen: der Zorn des Achilleus im Heldenepos Ilias, der tödliche Konflikt zwischen Kain und Abel im Koran und der Bibel. Im 15. Jahrhundert konnte bereits eine Beleidigung tödlich enden. Um die eigene Ehre wiederherzustellen und sich Genugtuung zu verschaffen, forderte der Beleidigte seinen Kontrahenten zu einem Duell auf Leben und Tod heraus. Denn hätte er die Beleidigung auf sich sitzen lassen, hätte er seinen gesellschaftlichen Status als Ehrenmann verloren.
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Gewalt ein gängiges Mittel, um Streit auszutragen. Beschimpfungen und Drohungen waren genauso Teil der Streitkultur wie der Gang vor Gericht. Im Unterschied zu heute galten Aggression und Gewaltanwendung in Konfliktfällen nicht als verwerflich oder unmoralisch und führten selten zum sozialen Ausschluss.
Unkontrollierte Gefühlsausbrüche hatten aber auch damals einen schlechten Ruf, auch die Gewalt unterlag Regeln. Stellte sie für die herrschende Ordnung explizit eine Gefahr dar, wurde sie abgelehnt. So war das Verprügeln eines Knechts durch seinen Herrn legitim und hielt die bestehende hierarchische Ordnung aufrecht. Sie durfte aber ein gewisses Maß nicht überschreiten, sichtbares Blut wurde als ein Zeichen dafür gesehen, dass der Herr es übertrieben hatte.
„Unsere Arbeitswelt ist bis heute überwiegend als emotionsfreier Raum konstituiert.“
Als sich in Westeuropa im 19. Jahrhundert dann zunehmend das staatliche Gewaltmonopol durchsetzte, verschwand individuelle Gewaltausübung als legitimes Mittel, um einen Streit beizulegen. Heute ist es so, dass mancherorts der Chef den Untergebenen noch anbrüllen kann, das wahrt die hierarchische Ordnung. Handgreiflichkeiten gelten aber auch in den konservativsten Unternehmen als Grenzüberschreitung.
Immer mehr Selbstregulation — auch und gerade am Arbeitsplatz
Der Soziologe Norbert Elias beschreibt diese Entwicklung, die bis heute andauert, als zunehmende individuelle Selbstregulierung, ein Kennzeichen für die Geschichte der menschlichen Zivilisation. Wer heute anderen in einem Streit an den Kragen geht, gilt als unausgeglichen, unzurechnungsfähig, ja vielleicht sogar unreif. Rationalität und Sachlichkeit werden als notwendige Voraussetzungen für eine gute Auseinandersetzung verstanden, Gefühle haben da nichts verloren, erst recht keine negativen.
Und das gilt besonders für den Arbeitskontext: Bis heute gehören Gefühle immer noch eher in die eigenen vier Wände, wenn überhaupt, und nur vernünftige Argumente in die Öffentlichkeit und den Arbeitsplatz. Unsere Arbeitswelt ist bis heute überwiegend als emotionsfreier Raum konstituiert. In der Industriegesellschaft spielten Gefühle bei der Arbeit keine Rolle. Der Körper galt als Arbeitskraft, Gefühle als hinderlich. Gefühlskompetenz wurde Frauen zugeschrieben, die dem häuslichen Bereich zugeordnet wurden. Wegen ihrer angeblich größeren Emotionalität und geringeren Weitsichtigkeit wurden sie aus vielen Tätigkeitsbereichen ausgeschlossen.
Warum sind Gefühle so wichtig beim Streiten?
Gefühle sind trotz ihres schlechten Rufs auch beim Streiten erst mal super. Sie helfen uns dabei, zu verstehen, wie es uns geht, und auf Erfahrungswissen zuzugreifen. Sich des eigenen Verstandes zu bedienen, heißt nicht, die eigenen Gefühle zu vergessen! Durch sie erleben wir einen Streit auch körperlich. Wer sie unterdrückt, um ein*e vermeintlich rationale*r und besonnene*r Streitpartner*in zu sein, unterdrückt damit nur ihren Ausdruck. Die negativen Gefühle selbst werden dadurch nicht bearbeitet — bestes Rezept für eine Eskalation des Konflikts.
Gefühle sind Voraussetzung für gute Argumente, Voraussetzung dafür, dass wir unseren Verstand überhaupt nutzen können. Die Neurobiologie der letzten 20 Jahre sagt klar: Komplexe Entscheidungen sind immer auch Gefühlsentscheidungen. Wer einen guten Zugang zu ihnen hat, handelt vernünftiger, Gefühle und Vernunft gehören zusammen. Gefühle zuzulassen, sie anzunehmen und ihnen zuzuhören, ist hilfreich und notwendig, um den Streit besser zu verstehen und fair zu sich selbst und dem Gegenüber zu sein.
„Konflikte? So etwas gibt es bei uns nicht“
Wo keine Gefühle sein dürfen, kann auch kein richtig guter Streit sein. Und das ist ein Problem für unsere Arbeitswelt. In der Dienstleistungsgesellschaft ist die Bedeutung von Gefühlen bei der Arbeit zwar gewachsen, trotzdem gilt in vielen Unternehmen noch eine Vorstellung von Professionalität, die vorgeblich ohne Gefühle auskommt. An den meisten Arbeitsplätzen herrscht die ungeschriebene Regel: Gefühle werden zu Hause gelassen. Karrierebibeln geben Tipps für mehr Impulskontrolle im Büro, Mitarbeiter*innen gehen zum Weinen auf die Toilette und nach Feierabend zum Boxen, um dort den Groll auf die Kolleg*in rauszulassen. Und in einer solchen Umgebung soll man streiten? Keine Chance!
„Um die produktiven Kräfte des Streitens für die Organisation zu nutzen, braucht es nicht noch mehr CEOs, die behaupten, dass die Mitarbeiter*innen natürlich auf Augenhöhe mit ihm oder ihr sprechen könnten.“
Was in klassischen Organisationen stattdessen häufig passiert, ist das vollständige Totschweigen von Unstimmigkeiten. „Konflikte? So etwas gibt es bei uns nicht“, ist der Lieblingsspruch aller Führungskräfte, die wirklich daran glauben, dass es nur gibt, was sie auch sehen können. Und wenn es doch mal lauter wird, handelt es sich meistens um einseitige Machtdemonstrationen, bei denen nur eine Person spricht und die andere Person schweigend dasitzt und wartet, bis es vorbei ist. Sowas verdient den Namen Streit nicht.
Streiten in der Pyramide
Dabei liegt dieser Umgang nicht an einer Unfähigkeit der Mitarbeiter*innen, sondern an den hierarchischen Strukturen. Denn wie sollen wir uns Kolleg*innen anvertrauen, wenn die Umgebung so gestaltet ist, dass das einzige Ziel der nächste Schritt auf der Karriereleiter ist, auf der es nur nach oben geht, wenn die Person, die oben sitzt, gut auf eine*n zu sprechen ist? Und wie soll ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden, wenn wir erst ein Stockwerk nach oben fahren, dort die geschlossene Tür zum Chef*innenbüro öffnen und an der*dem persönlichen Assistent*in vorbeigehen müssen, um schließlich mit unserer*m Vorgesetzten auf einem schweren Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches zu reden?
Um die produktiven Kräfte des Streitens für die Organisation zu nutzen, braucht es nicht noch mehr CEOs, die behaupten, dass die Mitarbeiter*innen natürlich auf Augenhöhe mit ihm oder ihr sprechen könnten. Eine gute Streitkultur entsteht nicht, indem wir sagen, wir hätten sie. Wer wirklich etwas ändern möchte, muss Strukturen für das Neue schaffen. Der Soziologe Anthony Giddens beschreibt in seiner Strukturationstheorie das Ineinanderwirken von Struktur und dem Handeln des*der Einzelnen. Für ihn braucht es immer beides. Strukturen produzieren Handeln ebenso wie sie selbst durch das Handeln produziert werden. Das ist die Chance neuer Organisationen.
Neue Organisationen als Heimat von Gefühlen
Die Frage ist nicht mehr, ob Gefühle und Streit etwas am Arbeitsplatz verloren haben, sondern, wie wir mit ihnen umgehen und was notwendige Voraussetzungen für eine faire und produktive Auseinandersetzung sind. Wir müssen das Unbehagen loswerden, das uns bei Streit so schnell befällt. Das müssen sich alle Organisationen, auch und insbesondere Organisationen neuen Typs, klarmachen, denn durch mehr Identifikation mit der Arbeit sind sie emotional aufgeladener.
„Wenn wir wollen, dass es Menschen an ihrem Arbeitsplatz gut geht, dass sie sich willkommen und gesehen fühlen, müssen sie in ihrem ganzen Selbst, also auch ihren negativen Gefühlen, da sein dürfen.“
Nichts gegen Umarmungen zur Begrüßung, gegen Wohlfühlduschen mit netten Komplimenten, gegen einen konstruktiven Umgang mit Feedback. Das ist alles total super. Aber es reicht nicht: Wir müssen auch lernen, mit negativen Gefühle umzugehen und uns, wenn es sein muss, auch mal richtig fetzen. Wenn wir wollen, dass es Menschen an ihrem Arbeitsplatz gut geht, dass sie sich willkommen und gesehen fühlen, müssen sie in ihrem ganzen Selbst, also auch ihren negativen Gefühlen, da sein dürfen.
Lasst uns streiten lernen
Streiten kann man lernen, Dissens auszuhalten auch, doch das geht nicht von heute auf morgen: In einer Organisation kommen verschiedene Menschen zusammen, mit ihren je eigenen Lebensgeschichten und kulturellen Prägungen. Wir können nicht einfach eine Konfliktkultur voraussetzen, sie muss im Miteinander entstehen.
Dafür muss eine Organisation die Wertschätzung für Auseinandersetzungen strukturell verankern und alle Mitarbeiter*innen brauchen die Möglichkeit, sich in das organisationale Geschehen einzubringen. Es braucht feste Routinen, um an Konflikten zu arbeiten, in denen ganz klar geregelt ist, was erlaubt ist und was nicht. Ernstgemeinte Check-in-Runden laden uns ein, zu reflektieren, wie es uns gerade wirklich geht. In Clear-the-Air-Meetings ist Raum, darüber zu sprechen, wenn jemand etwas getan hat, das eine*n frustriert oder unangenehme Gefühle ausgelöst hat.
Streitkompetenz fördern
Für Organisationen, die sich fetzen, braucht es aber noch mehr: nämlich eine Streitkompetenz bei ihren Mitgliedern. Wir streiten nur, wenn uns etwas wichtig ist. Damit wir von produktivem Streiten sprechen können, muss es auf beiden Seiten ein Interesse geben, offen und direkt zu kommunizieren und Lösungen zu finden, die über die eigenen Bedürfnisse hinausgehen.
Jede*r Einzelne kann selbst auf einen fairen und respektvollen Konfliktstil hinarbeiten. Es hilft zum Beispiel, zunächst zu verstehen, woher die eigene Wut kommt, anstatt gleich die Türen zu knallen. Vielleicht ist ein kleiner Spaziergang notwendig, um dann ruhig eine Nachfrage stellen zu können, ohne direkt im Vorwurfsmodus zu sein.
Grundlage ist, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, auch die schwierigen, sie anzunehmen und fair zu kommunizieren. Je besser wir darin werden, desto eher können wir den inneren Schweinehund überwinden und ein schwieriges Thema ansprechen. Und desto besser können wir bei einem Streit auf das Gegenüber eingehen, unsere Argumente aneinander schärfen und neue Perspektiven einnehmen.
Drei Take-Aways
1.Guter Streit braucht Gefühle. Sie helfen uns dabei, einen Streit auch körperlich zu erleben und sind Voraussetzung für gute Argumente.
2. Organisationen müssen Heimat von Gefühlen werden, um Heimat guten Streits zu sein. Sie müssen Strukturen schaffen, in denen sowohl positive als auch negative Gefühle einen Raum haben.
3. Organisationen brauchen Mitglieder mit Streitkompetenz: die nicht streiten, um ihre Macht zu demonstrieren, sondern fair miteinander umgehen und an einer produktiven Auflösung des Konflikts interessiert sind.